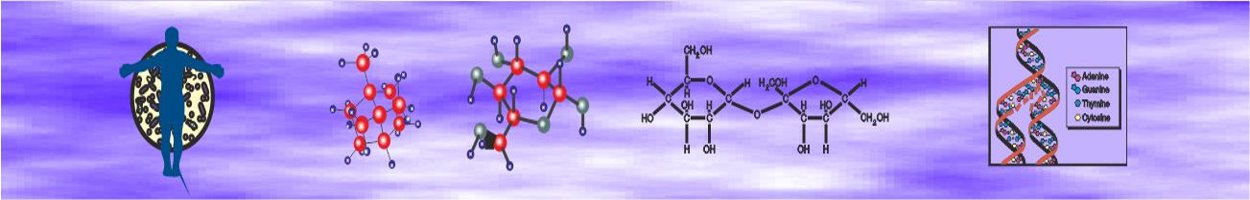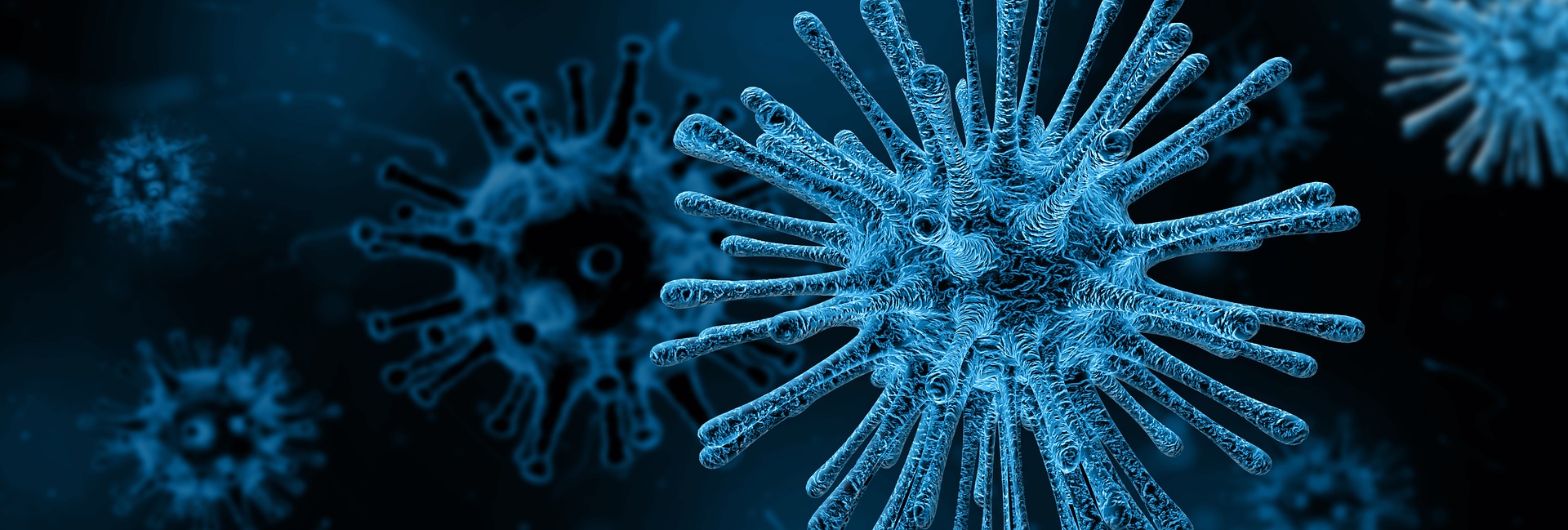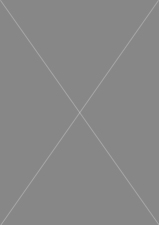Die letzten Meldungen
Language connection discovered in chimpanzee brains
15. Mai 2025
Language processing in humans depends on the neuronal connection between language areas in the brain. Until recently, this language network was thought to be uniquely human. Now, in a discovery about the evolutionary basis of our language, researchers of the Max Planck Institute for Human Cognitive and Brain Sciences, in collaboration with the Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology and the Alfred Wegener Institute, have identified a comparable neuronal connection in the brains of chimpanzees. Their findings have been published in the journal Nature Communications.
Nervenfasern für Sprache beim Schimpansen entdeckt
15. Mai 2025
Die Sprachverarbeitung beim Menschen basiert auf der neuronalen Verbindung zwischen Spracharealen im Gehirn. Dieses Sprachnetzwerk, das den Informationsaustausch zwischen Nervenzellen ermöglicht, galt bisher als einzigartig für den Menschen. Nun haben Forschende eine wichtige Entdeckung zur evolutionären Entwicklung unserer Sprache gemacht: Unter der Leitung des Max-Planck-Instituts für Kognitions- und Neurowissenschaften und in Zusammenarbeit mit dem Max-Planck-Institut für Evolutionäre Anthropologie und dem Alfred-Wegener-Institut haben sie erstmals eine solche Verbindung im Gehirn von Schimpansen nachgewiesen und in der Zeitschrift „Nature Communications“ vorgestellt.
Dual Associations with Two Fungi Improve Tree Fitness
15. Mai 2025
When trees and soil fungi form close associations with each other, both partners benefit. Many tree species have further enhanced this cooperation by forming a concurrent symbiosis with two different groups of mycorrhizal fungi. Those trees cope better with water and nutrient scarcity, which is an important trait for forestry in the face of climate warming.
Bei Trockenheit ignorieren Pflanzen Schwerkraft und suchen nach Wasser
15. Mai 2025
Wurzeln „spüren“ nicht nur die Schwerkraft, um sich im Boden auszubreiten und sich zu verankern. Bei Bedarf können sie auch die eingeschlagene Wachstumsrichtung verändern und Wasserquellen erreichen. Eine neue Studie von Wissenschafter:innen des Institute of Science and Technology Austria (ISTA) und der Northwest A&F University in China zeigt nun, dass Trockenheit diese Richtungsänderung erleichtert, indem sie die Wahrnehmung der Schwerkraft unterdrückt. Diese Erkenntnisse könnten dazu beitragen, Pflanzen zu entwickeln, die extremen Wetterbedingungen besser standhalten.
Plants ignore gravity during droughts to forage for water
15. Mai 2025
Roots ‘feel’ gravity to extend and anchor themselves in the soil, but they can alter their growth direction toward a water source when needed. However, according to a new study by scientists at the Institute of Science and Technology Austria (ISTA) and Northwest A&F University in China, this change is promoted by drought conditions, which suppress the roots’ gravity sensing ability. These insights could be useful for developing plants capable of withstanding extreme weather conditions.
Greifmuster unserer Vorfahren
15. Mai 2025
Forschende haben in Südafrika neue Hinweise darauf gefunden, wie unsere fossilen menschlichen Verwandten ihre Hände benutzt haben könnten. Unter der Leitung von Samar Syeda, Postdoc am American Museum of Natural History, und in Zusammenarbeit mit Forschenden des Max-Planck-Instituts für evolutionäre Anthropologie, der University of the Witwatersrand, der University of Kent, der Duke University und der National Geographic Society hat das Team Unterschiede in der Morphologie der Fingerknochen untersucht und festgestellt, dass südafrikanische Homininen nicht nur unterschiedlich geschickt waren, sondern auch unterschiedliche Kletterfähigkeiten besaßen.
Neue BfR -Webseite ist online
15. Mai 2025
Optimierte Risikokommunikation für den gesundheitlichen Verbraucherschutz
Auf der Spur der Falten – in der Quantentechnologie
15. Mai 2025
Was ein zerknülltes Blatt Papier mit Quantentechnologie zu tun hat: Ein Forschungsteam der EPFL in Lausanne (Schweiz) und der Universität Konstanz nutzt die Topologie in der Mikrowellenphotonik, um Systeme von miteinander gekoppelten Quantenresonatoren zu verbessern.
Global Wine Tourism Report 2025
15. Mai 2025
International Research Collaboration to Deliver Key Insights to the Sector
Globaler Weintourismus-Bericht 2025
15. Mai 2025
Internationale Forschungspartnerschaft liefert entscheidende Erkenntnisse für die Branche
„Wildbienen sind die Versicherung unserer Ernten.“
14. Mai 2025
Am 20. Mai ist Weltbienentag. Im Interview spricht Prof. Dr. Alexandra-Maria Klein über die Bedeutung von Wildbienen als Bestäuber unserer Nutzpflanzen.
Wildbienen sichern unsere Ernährung, indem sie ergänzend zu Honigbienen unser Obst und Gemüse bestäuben und damit Menge und Qualität der Früchte verbessern.
Landwirt*innen und Gärtner*innen können Wildbienen mit einfachen Mitteln fördern und so den Ertrag ihrer Ernten steigern. Anleitung dazu gibt ein neues Praxishandbuch.
Wie eine flexible Proteindomäne Gentranskription und RNA-Verarbeitung verknüpft
14. Mai 2025
Dr. Tanja Bhuiyan und ein Team von Forschenden der Universität Freiburg entdeckeneinen Mechanismus, der neue Einblicke in die molekulare Steuerung der Genregulation ermöglicht.
Die Ergebnisse legen nahe, dass der Transkriptionsfaktor TAF2 das alternative Spleißen bestimmter mRNAs beeinflusst.
Die Studie offenbart eine regulatorische Funktion einer konservierten IDR, die die räumliche Organisation von Genregulation und RNA-Verarbeitung miteinander verbindet.
Weltbienentag am 20. Mai: 40 Wildbienenarten in Deutschland bereits ausgestorben
14. Mai 2025
Wildbienen gelten als Nahrungsspezialisten. Häufig sammeln sie ihren Nektar nur an wenigen oder sogar nur an einer einzigen Pflanze. Fehlt diese, fehlen in dem Gebiet auch die Wildbienen, die auf sie spezialisiert sind. In Deutschland sind etwa 600 Arten davon bekannt, von denen bereits 40 Arten ausgestorben und über 50 Prozent gefährdet sind, wie die Tierärztinnen Dr. Julia Dittes und Dr. Ilka Emmerich von der Veterinärmedizinischen Fakultät der Universität Leipzig anlässlich des am 20. Mai bevorstehenden Weltbienentages sagen. Die beiden Expertinnen betreuen die Honigbienenvölker ihrer Fakultät und kennen sich nicht nur mit Wildbienen aus.
Malaria: Smartes Sprühgerät erleichtert Seuchenbekämpfung
14. Mai 2025
Im Kampf gegen Malaria schwärmen vielerorts auf der Welt Helfer aus und versprühen ein Insektizid in Wohnhäusern. Die Daten, die sie nach dem Sprühen erheben, sollen künftig digital erfasst und übertragen werden. Das vermeidet unnötige Fehler und erleichtert die Planung künftiger Einsätze.
Mit Abnehmspritzen gegen Alzheimer-Demenz?
14. Mai 2025
GLP-1-Rezeptoragonisten und SGLT2-Inhibitoren könnten nach einer neuen Studie das Alzheimer-Risiko senken. Ähnliches hatten auch schon andere Erhebungen gezeigt. Allerdings handelt es sich nicht um randomisierte Studien, weshalb die Deutsche Gesellschaft für Neurologie im Hinblick auf Empfehlungen zur Alzheimer-Prophylaxe zurückhaltend ist. Dafür seien mehr Daten erforderlich. Eine vergleichbar hohe Reduktion des Demenzrisikos könne ebenso durch Lebensstilmodifikationen erreicht werden – und zwar mit deutlich weniger Kosten, nebenwirkungsfrei und vor allem nachhaltig. Denn was nach Absetzen der „Abnehmspritze“ im Hinblick auf das Demenzrisiko passiert, ist bisher nicht erforscht.
Feinstaubmessung, um die Belastung zu Fuß oder per Rad zu reduzieren
14. Mai 2025
Wissenschaftler*innen entwickeln in Kooperation mit Unternehmen eine Prototyp-App, die erstmals eine personalisierte Analyse der Feinstaubbelastung auf Rad- und Fußwegen ermöglicht und damit eine neue Datenbasis für eine gesundheitsorientierte Stadtplanung liefert.
Multidisziplinäre Versorgung bei Mukoviszidose zahlt sich aus
14. Mai 2025
Das Universitäts-Mukoviszidose Centrum setzt auf intersektorale Zusammenarbeit bei Diagnose und Therapie. | Davon profitieren Patientinnen und Patienten, die am Uniklinikum ambulant und stationär behandelt werden. | Das interdisziplinäre Zentrum wurde erneut für die umfassende Versorgung Betroffener zertifiziert.
Mit KI genetische Störungen in Zellbildern erkennen
14. Mai 2025
Forschende am Paul Scherrer Institut PSI haben eine künstliche Intelligenz entwickelt, die einen neuen, kostengünstigen Ansatz zur Identifikation genetischer Störungsmuster in Zellbildern eröffnen könnte – mit Potenzial für die Entwicklung neuer Medikamente.
Ernennung zum Professor
14. Mai 2025
Die Ruhr-Universität Bochum hat den Kardiologen und Privatdozenten Dr. med. Henrik Fox vom Herz- und Diabeteszentrum NRW (HDZ NRW), Bad Oeynhausen, zum außerplanmäßigen Professor ernannt.
Fokus auf Paradigmenwechsel: Dagmar Führer-Sakel neue DGIM-Vorsitzende
14. Mai 2025
Die Deutsche Gesellschaft für Innere Medizin e. V. (DGIM) hat eine neue Vorstandsvorsitzende: Professorin Dr. Dr. med. Dagmar Führer-Sakel, Direktorin der Klinik für Endokrinologie, Diabetologie und Stoffwechsel am Universitätsklinikum Essen, übernimmt zum Abschluss des 131. Internistenkongresses das Amt von Professor Dr. med. Jan Galle. In ihrer neuen Funktion wird Führer-Sakel den 132. Internistenkongress vom 18. bis 21. April 2026 in Wiesbaden ausrichten. Der Kongress steht unter dem Leitthema „Paradigmenwechsel in der Inneren Medizin – die Zukunft gestalten“.
Neuer Ansatz für die Entwicklung von Arzneimitteln zur Behandlung der Hauterkrankung Psoriasis
13. Mai 2025
Ein Forschungsteam der Unimedizin Mainz hat neue, wegweisende Erkenntnisse über die Entstehung der Autoimmunerkrankung Psoriasis gewonnen. Die Wissenschaftler:innen fanden heraus, dass die Fettsäureproduktion (FAS) ein zentraler Stoffwechselprozess ist, der die Entzündungsreaktion bei der Hauterkrankung vorantreibt. Diese Reaktion wird bei Psoriasis durch bestimmte Immunzellen – sog.Gamma-Delta-T17-Zellen – ausgelöst. Der gezielte Eingriff in die FAS reduzierte die durch diese Immunzellen vermittelte Entzündung deutlich. Damit haben die Forschenden einen potenziellen Ansatz für die Entwicklung von Arzneimitteln zur Behandlung der Psoriasis und anderer entzündlicher Erkrankungen entdeckt.
Fortschritt bei Krebsbehandlung: S3-Leitlinie zur chronischen lymphatischen Leukämie aktualisiert
13. Mai 2025
Die Neuauflage der S3-Leitlinie „Diagnostik, Therapie und Nachsorge für Patient*innen mit einer chronischen lymphatischen Leukämie (CLL)” zeigt eindrucksvoll die enormen Fortschritte, die in den vergangenen Jahren bei der Krebsbehandlung und speziell bei der Erkrankung des lymphatischen Systems gemacht wurden. Das ist insbesondere für die Geriatrie erfreulich, denn das durchschnittliche Alter bei einer CLL-Erstdiagnose liegt bei ungefähr 70 Lebensjahren.
Manual for Cultivating Algae in the Laboratory
13. Mai 2025
A team of biophysicists led by Prof. Dr. Oliver Bäumchen at the University of Bayreuth and biologists led by Dr. Maike Lorenz at the Culture Collection of Algae at Göttingen University has published a step-by-step guide for the reliable cultivation of the unicellular green alga Chlamydomonas reinhardtii. The guide will support researchers worldwide in the fields of life sciences, biophysics, and bioengineering in their investigations of biological, biophysical, and biotechnological principles. Their reliable cultivation methods are detailed in Nature Protocols.
Handbuch für die Algenkultivierung im Labor
13. Mai 2025
Ein Forschungsteam aus Biophysikern um Prof. Dr. Oliver Bäumchen der Universität Bayreuth und Biologen um Dr. Maike Lorenz der Algensammlung der Universität Göttingen hat eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zur verlässlichen Kultivierung der einzelligen Grünalge Chlamydomonas reinhardtii veröffentlicht. Damit unterstützen sie weltweit Forschende aus den Bereichen Biowissenschaften, Biophysik und Bioengineering bei der Erforschung biologischer, biophysikalischer und biotechnologischer Prinzipien. Ihre zuverlässigen Kultivierungsmethoden beschreiben sie in Nature Protocols.
Gemeinsam statt einsam: Neuer Datenansatz macht Pflanzenvorhersagen präziser
13. Mai 2025
Große Datenmengen („Big Data“) bieten ein enormes Potenzial, um die Genauigkeit genomweiter Vorhersagen in der Pflanzenzüchtung zu verbessern. Ermutigt durch erfolgreiche Ergebnisse bei Weizenhybriden haben Forschende am IPK Leibniz-Institut diesen Ansatz nun auch auf sogenannte Inzuchtlinien ausgeweitet. Dazu kombinierten sie erstmals phänotypische und genotypische Daten aus insgesamt vier kommerziellen Weizenzuchtprogrammen. Die Ergebnisse der Studie wurden im „Plant Biotechnology Journal“ veröffentlicht.