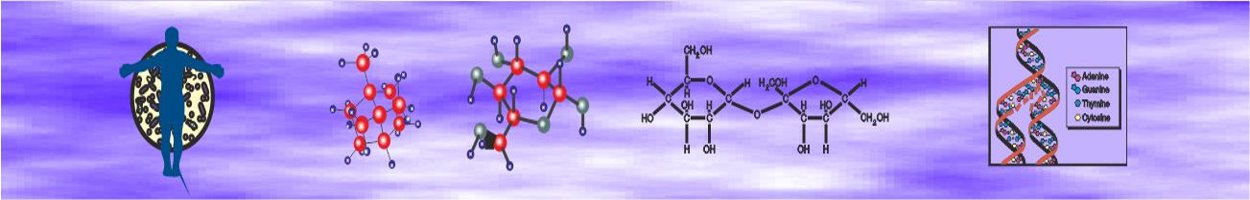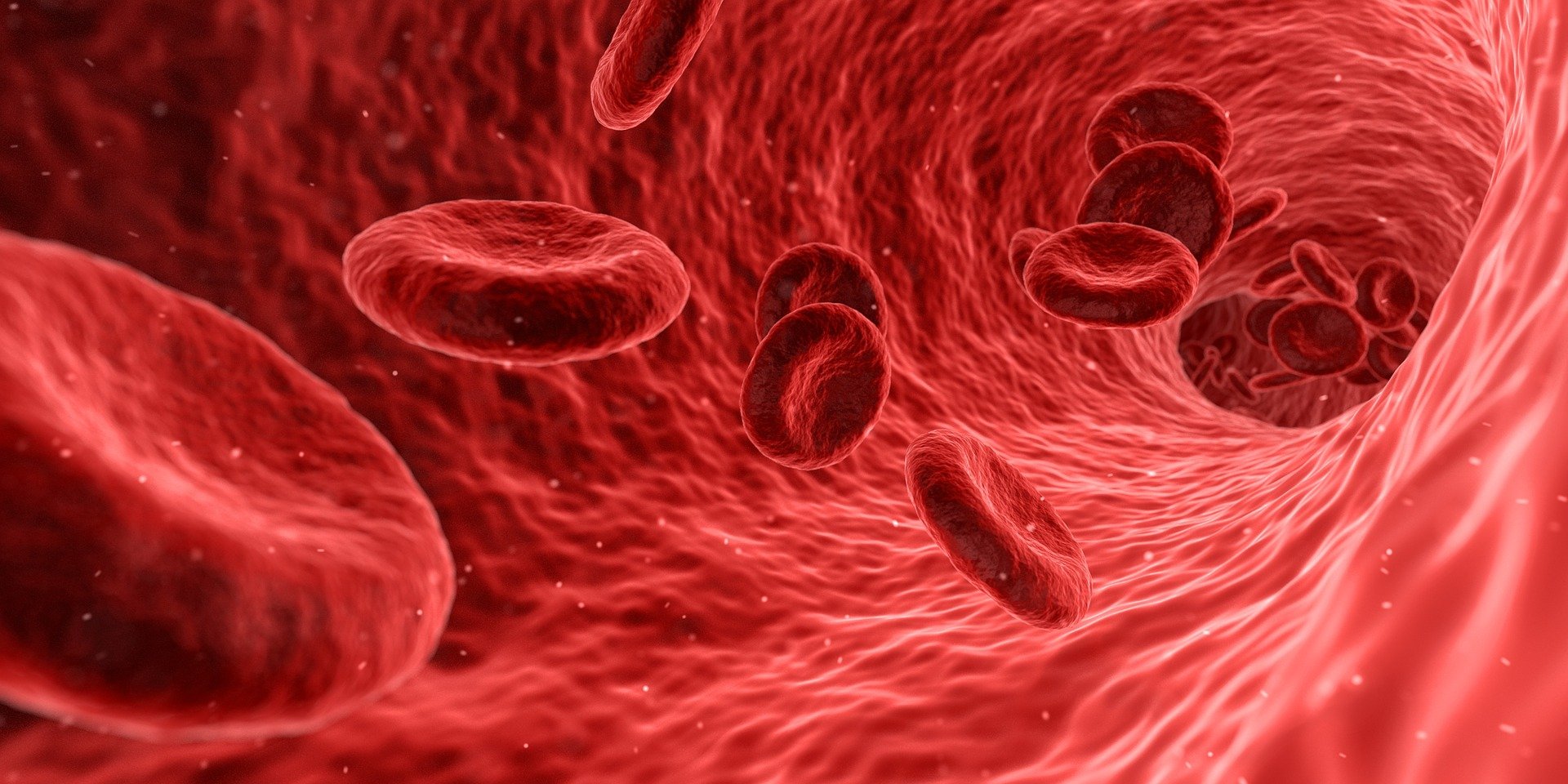Die letzten Meldungen
Ein molekularer Oktopus steuert die Eiweiss-Synthese
20. Dezember 2025
Seit Jahren untersuchen Forschende der ETH Zürich einen molekularen Komplex, der eine Schlüsselrolle bei der Proteinsynthese spielt. Nun haben sie herausgefunden, dass dieser Komplex auch eine entscheidende Funktion dazu beiträgt, dass unsere DNS richtig bearbeitet und verpackt wird.
Die Stellschrauben für ein nachhaltiges Agrar- und Ernährungssystem
20. Dezember 2025
Eine große Modellstudie zeigt jetzt, welchen Beitrag das weltweite Agrar- und Ernährungssystem beim Kampf gegen die Erderhitzung leisten kann. Sie benennt 23 Stellschrauben, kalkuliert ihre Wirkungskraft – und trifft die Aussage: Eine entschlossene Transformation allein dieses Bereichs, ohne die unverzichtbare Energiewende, kann den globalen Temperaturanstieg gegenüber dem vorindustriellen Niveau auf 1,85 Grad bis zum Jahr 2050 begrenzen. Zudem wird die Ernährung gesünder und preiswerter, und die Landwirtschaft wird besser vereinbar mit dem Schutz der Biodiversität. Die Studie wurde geleitet vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung (PIK) und publiziert in Nature Food.
Herbert-Lewin-Preis würdigt Forschung zu Lebensgeschichten in der Psychiatrie im Nationalsozialismus
20. Dezember 2025
Magdeburger Medizinhistorikerin zeigt, wie fünf Menschen im annektierten Elsass zwischen 1941 und 1944 psychiatrische Behandlung, Ausgrenzung und Gewalt erlebten
Festtage: Bei Herzinfarkt-Warnzeichen sofort Notruf 112 absetzen
20. Dezember 2025
Längere Feiertagsphase: Auch während der Festtage keine Scheu vor Notruf 112 bei Herzinfarkt-Verdacht. Herzstiftung erklärt, wer besonders gefährdet ist und gibt Tipps, wie man Risiken gegensteuert
Konkurrenz oder Kooperation
20. Dezember 2025
Studie zeigt, wie sich Zweiergruppen bei einer gemeinsamen Aufgabe koordinieren
Wie sich das Schicksal einer T-Zelle entscheidet
19. Dezember 2025
Ein zellulärer Reinigungsprozess, die Autophagie, trägt entscheidend dazu bei, dass T-Zellen sich richtig teilen. Das berichten Forschende um Katja Simon vom Max Delbrück Center in „Nature Cell Biology“. Die Studie könnte helfen, die Impfstoffreaktion älterer Menschen zu verbessern.
Das Erbe des bleihaltigen Benzins: Wie Bleiemissionen den Arktischen Ozean belasten
19. Dezember 2025
Der Arktische Ozean galt lange Zeit als nahezu unberührter Raum. Doch Messungen zeigen: Das Nordpolarmeer nimmt einen großen Teil des vom Menschen in Umlauf gebrachten Bleis aus dem Nordatlantik auf. An einigen Stellen ist die Konzentration des giftigen Schwermetalls im Meeresboden so hoch, dass Organismen geschädigt werden könnten. Der Klimawandel und der damit einhergehende Verlust des Meereises bergen zudem die Gefahr, dass bleihaltige Sedimente zu einer Quelle von hochgiftigem, gelöstem Blei werden. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie der TU Braunschweig, des GEOMAR Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung Kiel und weiterer Partner, die in „Nature Communications“ veröffentlicht wurde.
3D-Bilder aus dem Körper schärfer gemacht
19. Dezember 2025
Forschungsteam optimiert Mikroskop mit neuartiger Technologie
Lichtblattmikroskope machen Gewebe und ganze Organe in eindrucksvollen 3D-Bildern sichtbar, etwa die filigrane Hörschnecke im Innenohr oder das komplexe Gehirn einer Maus. Eine dünne Schicht aus Licht, das Lichtblatt, bewegt sich dabei durch die Probe und erzeugt Ebene für Ebene ein dreidimensionales Abbild. Bei größeren Proben stoßen herkömmliche Geräte jedoch an Grenzen: Sie sind langsam und liefern unscharfe Bilder. Eine technologisch neuartige Plattform für Lichtblatt-Fluoreszenzmikroskope verbessert die Bildgebung und eröffnet damit neue Perspektiven für Forschung und Medizin.
Mit Maniok den Hunger bekämpfen
19. Dezember 2025
Genmodifizierte Pflanzenvariante zeigt sich trockenheitsresistent und verspricht höhere Ernten
Krebserkrankungen: Wie Tumoren Neutrophile gezielt umprogrammieren
19. Dezember 2025
Forscher:innen der Medizinischen Fakultät der Universität Duisburg-Essen (UDE) unter der Leitung von Prof. Dr. Jadwiga Jablonska haben einen bislang unterschätzten Mechanismus identifiziert, der erklärt, warum Krebspatient:innen ein erhöhtes Risiko für bakterielle Infektionen aufweisen: Tumoren können Neutrophile so umprogrammieren, dass zentrale antimikrobielle Abwehrmechanismen geschwächt werden. Die Studie wurde im Rahmen der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) gefördert.
Pathogen hijacks fruit ripening program in citrus plants
19. Dezember 2025
University of Tübingen-led international research team discovers how a bacterium obtains additional nutrients for reproduction at the expense of the plant
Krankheitserreger kapert Programm zur Fruchtreife bei Zitrusgewächsen
19. Dezember 2025
Internationales Forschungsteam unter Leitung der Universität Tübingen entdeckt, wie sich ein Bakterium bei der Infektion auf Kosten der Pflanze zusätzliche Nährstoffe für die Vermehrung verschafft
How people see animals: They think and feel – but not like us
19. Dezember 2025
Do animals think and feel? How this question is answered has a direct bearing on how empathetically and considerately people treat animals. An international team led by researchers in Leipzig has now found that people from different cultural contexts are surprisingly consistent in their views: while many adults and children assume that animals are generally capable of thinking and feeling, they do not attribute human-like thoughts to them.
Die Uhr zurückdrehen – die neue Ausgabe des „einblick“ ist erschienen
19. Dezember 2025
Wäre es nicht großartig, wenn man die biologische Uhr zurückdrehen könnte? Wenn sich Alterungsprozesse stoppen oder sogar rückgängig machen ließen? Wir stellen ein Forschungsteam vor, das die „epigenetische Uhr“ der Haut untersucht. An ihr lässt sich ablesen, wie sehr UV-Strahlung, der Lebensstil und andere Faktoren die Alterung der Hautzellen vorangetrieben haben. Die Forschenden suchen nach Wegen, diese molekulare Uhr auf ein jüngeres Alter zurückzustellen – und damit auch das Hautkrebsrisiko zu senken. Mehr dazu und viele weitere Themen finden Sie in der neuen Ausgabe des einblick.
Blasen verstärken die CO2-Aufnahme des Ozeans stärker als bislang angenommen
19. Dezember 2025
Der Ozean könnte deutlich mehr Kohlendioxid (CO2) aufgenommen haben als bisher berechnet. Eine neue Studie des GEOMAR Helmholtz-Zentrums für Ozeanforschung Kiel und des Plymouth Marine Laboratory beweist, dass der Gasaustausch zwischen Luft und Meer nicht symmetrisch verläuft, sondern der globale Ozean rund 15 Prozent mehr CO2 bindet, als gängige Berechnungen nahelegen. Besonders in windreichen Regionen verstärken Luftblasen in brechenden Wellen die Aufnahme von CO2. Die Ergebnisse basieren auf umfangreichen direkten Messungen aus dem Ozean. Sie sind jetzt in dem Fachjournal Nature Communications veröffentlicht worden.
Studie zeigt: Jüngere Generationen liegen beim Faktenwissen zu Organspende vorn
18. Dezember 2025
Jüngere wissen besser Bescheid: Beim Faktenwissen zur Organ- und Gewebespende liegt die Generation unter 35 vorn. Das zeigt der neu veröffentlichte Gesamtbericht zur Repräsentativbefragung des Bundesinstituts für Öffentliche Gesundheit. Zudem zeigt die Studie: Viele Menschen haben beim Thema Hirntod Unsicherheiten. Vier Filme des Bundesinstituts für Öffentliche Gesundheit räumen deshalb mit verbreiteten Irrtümern auf und erklären die medizinischen Grundlagen des Hirntods einfach und klar.
Winzige Archive: Stoffwechsel-Moleküle speichern Urzeitwelt
18. Dezember 2025
Ein internationales Team mit Senckenberg-Forschern hat eine neue Methode entwickelt um zu untersuchen, wie der Lebensraum urzeitlicher Tiere und Menschen aussah. Ihre jetzt im renommierten wissenschaftlichen Fachjournal „Nature“ veröffentlichte Studie unter Leitung von Prof. Timothy Bromage (New York University) zeigt, dass fossile Tierknochen und -zähne weit mehr Informationen bewahren als bislang angenommen. In den Hartgeweben bleiben kleinste Spuren von Stoffwechselprodukten über Jahrmillionen erhalten. Die Analyse dieser Moleküle – sogenannte Metaboliten – ermöglicht Rückschlüsse auf Ernährung, Klima und Landschaften an bedeutenden Fundstellen der frühen Menschheitsgeschichte in Afrika.
Online-Vortrag: „Growth Mindset: Wie wir persönlich wachsen – und was uns daran hindern kann“
18. Dezember 2025
Im Rahmen des Online-Vortrags mit dem Titel „Growth Mindset: Wie wir persönlich wachsen – und was uns daran hindern kann“ arbeiten die Psychologin Annica Paul-Poudevigne und Prof. Dr. Marcus Eckert, Professor für Psychologie, am 13. Januar 2026 um 18:00 Uhr gemeinsam die vielfältigen Faktoren heraus, welche die Bildung einer wachstumsorientierten Haltung günstig beeinflussen können.
Forschungsprojekt an der HfWU zur Torfminderung im Hobbygartenbau weiter gefördert
18. Dezember 2025
Das Verbundvorhaben HOT2, aufbauend auf den Erkenntnissen aus dem Modell- und Demonstrationsvorhaben „HOT – Hobbygartenbau ohne Torf“ wird weiter vom Bund gefördert. Das Projektkonsortium von der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen (HfWU), der Hochschule Weihenstephan-Triesdorf und der Fachhochschule Erfurt arbeitet ab Januar 2026 weiter an der Forschung zur Torfminderung im Hobbygartenbau.
Nikotin bleibt ein global bedeutsamer Herz-Kreislauf-Risikofaktor
18. Dezember 2025
Ein internationales Team führender Herz- und Gefäßexpert:innen, darunter Univ.-Prof. Dr. Thomas Münzel, Seniorprofessor an der Universitätsmedizin Mainz und Vorsitzender der Task Force Environment & Sustainability der European Society of Cardiology (ESC), Prof. Dr. Thomas F. Lüscher, Präsident der ESC, Prof. Dr. Filippo Crea, Chefredakteur des European Heart Journal, und Prof. Dr. Sanjay Rajagopalan von der Case Western Reserve University in Cleveland (USA), legt eine umfassende wissenschaftliche Analyse zur Rolle von Nikotin als Herz-Gefäß-Risikofaktor vor. Heute wurde sie im European Heart Journal veröffentlicht.
Individuelle Unterschiede im Erbgut machen manche Therapien wirkungslos
18. Dezember 2025
Das Genom unterscheidet sich von Mensch zu Mensch an Tausenden Positionen. In manchen Fällen hat das zur Folge, dass auch Proteine stellenweise einen anderen Baustein aufweisen. Das kann dazu führen, dass bestimmte antikörperbasierte Therapien nicht wirken, berichten Forschende der Universität Basel.
Patient-specific human liver model to understand disease mechanisms
18. Dezember 2025
Dresden research team develops human modular “LEGO-like” model that lays foundation for a new era in liver research.
Patientenspezifisches Modell der menschlichen Leber zur Erforschung von Krankheiten
18. Dezember 2025
Dresdner Forschungsteam entwickelt modulares „LEGO-ähnliches” Modell , das den Grundstein legt für eine neue Ära in der Erforschung der Leber.
Pilz verarbeitet Möhrenreste zu schmackhaftem Protein
18. Dezember 2025
Myzelien des Rosenseitlings als nachhaltige und hochwertige Proteinquelle – Studie von Forschenden der Justus-Liebig-Universität Gießen und der Technischen Hochschule Mittelhessen
Wie „Hangover“ der Fruchtfliege beim Alkoholstress hilft
18. Dezember 2025
Studie zeigt, dass spezifische Schaltvorgänge im Erbgut die Alkoholtoleranz der Fruchtfliege bestimmen