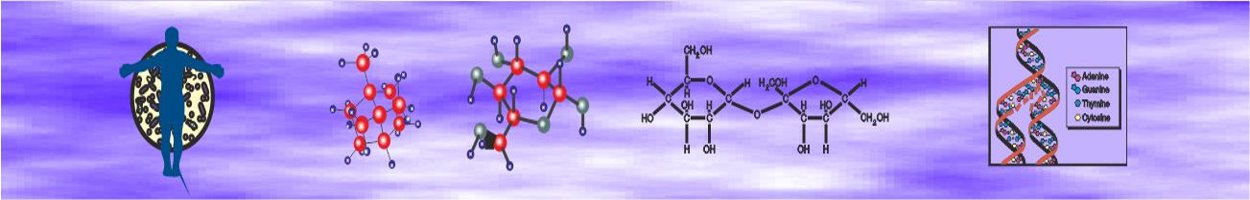Schlagwort: Erreger
Influenza: Erreger in Fledermäusen umgeht menschlichen Abwehrmechanismus
Wie das Immunsystem von harmlosen Partikeln lernt
Cholera-Erreger machtlos gegen eigenes Immunsystem
Auch Bakterien haben ein eigenes Immunsystem, dass sie gegen spezielle Viren – sogenannte Bakteriophagen – schützt. Ein Forschungsteam der Universitäten Tübingen und Würzburg zeigt nun, wie das Immunsystem die Wirkung von bestimmten Antibiotika gegen den Cholera-Erreger Vibrio cholerae verstärkt. Das Immunsystem ist der Grund, warum dieses Bakterium besonders empfindlich auf eine der ältesten bekannten Antibiotikaklassen – die Antifolate – reagiert. Die Ergebnisse wurden in der Fachzeitschrift Nature Microbiology veröffentlicht.
Tuberkulose behandeln, wenn Antibiotika nicht mehr wirken
EU fördert Forschung zu Ursachen und neuen Therapien der Multiplen Sklerose
Leberentzündungen und Durchfall bei Kleinkindern
Weitere Verbreitung von Carbapenem-resistentem Acinetobacter baumannii muss vermieden werden
So passt sich der Krankenhauskeim Acinetobacter baumannii schnell an neue Umweltbedingungen an
Neue Erkenntnisse zur Evolution des Pesterregers
Forschungsteam von CAU und MPI Plön identifiziert genetische Faktoren, die der Erreger Yersinia pestis während seiner jüngsten Entwicklung erworben hat und die zum Verständnis der Entstehung der modernen Pestpandemie im 19. Jahrhundert beitragen
Blasenentzündungen mit Viren bekämpfen
Resistente Reissorten gegen Ausbruch einer bakteriellen Erkrankung in Afrika
Reisforschung: Veröffentlichung in eLife
Das internationale Forschungskonsortium „Healthy Crops“ unter Leitung von Prof. Dr. Wolf B. Frommer von der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf (HHU) befasst sich mit der Entwicklung krankheitsresistenter Reissorten. In der Fachzeitschrift eLife berichten die Autorinnen und Autoren jetzt von der Entdeckung einer jüngst in Tansania ausgebrochenen Bakterieninfektion – und beschreiben, wie sie eine afrikanische Reissorte so verändert haben, dass sie gegen den Erreger resistent ist.
Rußig ohne Feuer – Vorsicht vor diesen Pilzsporen!
Optimierte Naturstoffe als Schlüssel zur Behandlung bei chronischer Lungenerkrankung?
Saarbrücker Antibiotikaprojekt wird durch Inkubator INCATE gefördert
Toxoplasmose: Erreger mit molekularem Universalschlüssel
Neues Antibiotikum gegen resistente Keime entdeckt
Zwei Erreger mit einer Klappe
Bürstenzellen wittern Erreger und wehren sich
Proteinmaschine der Atmung wird sichtbar
• Damit ist der Superkomplex der Zellatmung vom Aktinobakterium Corynebacterium glutamicum analysiert. Diese Erkenntnisse über die Funktionsweise der Atmungskettenmoleküle sind auf viele Organismen übertragbar.
• Unterschiede zum Menschen können helfen, neue Wirkstoffe gegen verwandte Bakterien – etwa Erreger von Diphterie und Tuberkulose – zu entwickeln.
Womöglich ist die Omikron-Variante von Tieren auf den Menschen übergesprungen

Mit dem Pandemievirus stecken sich immer mehr Arten an. Theoretisch könnten mehr als 500 Spezies als Reservoir für den Erreger dienen. Welche Rolle spielen sie in der Entwicklung von Omikron?
Dem Ursprung von Cholerapandemien auf der Spur
Omikron: Was über die Entstehung der neuen Corona-Variante bekannt ist
Forschung an der Uni Gießen: Der Trick des Malaria-Erregers

Gießener Forscher haben ein Protein identifiziert, das es dem Erreger der Malaria erlaubt, Zellen für seine Zwecke umzufunktionieren. Die Entdeckung könnte neue Optionen zur Behandlung der Tropenkrankheit eröffnen.
Neuer Wirkstoff gegen Parasiten
Warum Delta mit seinen speziellen Mutationen zur dominierenden Variante wurde

Delta dominiert die vierte Welle im Land. Was zeichnet den Erreger aus, und wie hat er die Pandemie verändert? Die Genomdaten und Fallzahlen geben Aufschluss. Eine Entschlüsselung in Schaubildern.