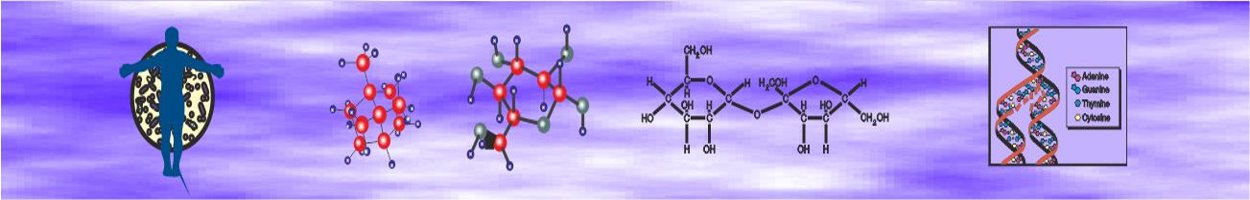Die letzten Meldungen
How birds achieve sweet success
• Patterns of change: Some genetic changes were unique to each group, but many were shared across two or more groups, including key genes involved in sugar processing and blood pressure regulation.
• Metabolic adaptation: Lab experiments confirmed genetic changes that enhance sugar processing – insights that may help researchers better understand how animals evolved to thrive on high sugar diets.
Zuckerreiche Nahrung: Stoffwechselanpassung bei Vögeln
– Einige genetische Veränderungen kommen nur in einer Gruppe vor, aber viele in zwei oder mehr Gruppen. Darunter sind Gene, die eine Rolle bei der Zuckerverarbeitung und Blutdruckregulation spielen
– Laborexperimente bestätigen genetische Veränderungen, welche die Zuckerverarbeitung verbessern. Dadurch verstehen wir besser, wie sich Tiere an eine zuckerreiche Diät angepasst haben
5000. Proteinstruktur an BESSY II: Startpunkt für einen COVID-Wirkstoff
Hummeln sind effiziente Entscheider
Stadtgrün: Gesundheitsbooster oder Pollenfalle?
Neu aufgelegt: das Kochbuch der Deutschen Leberstiftung für eine lebergesunde Ernährung in aktualisierter Auflage
Tuberkulose systematisch bekämpfen: Wie die Umgebung das TB-Risiko prägt
Dr. Anja Schork Receives “Junior Faculty Award 2025”
Dr. Anja Schork mit „Junior Faculty Award 2025“ ausgezeichnet
How oxygen enriched the Earth’s atmosphere 2.5 billion years ago
A tale of coevolution: Nuclear speckles aid GC-rich RNA processing
Eine Geschichte der Koevolution: Sprenkel im Zellkern helfen bei der RNA Verarbeitung
Gefährdete Naturstoff-Apotheke im Korallenriff
Hinter den Medaillen: Sportmedizin als stiller Erfolgsfaktor bei den Olympischen Winterspielen
New professorship for Structural Virology at BNITM
Dr Maria Rosenthal has taken up her professorship in Structural Virology at the Bernhard Nocht Institute for Tropical Medicine (BNITM) and the University Medical Centre Hamburg-Eppendorf. The professorship is funded as part of the Leibniz Programme for Female Professors. Rosenthal and her team are researching new therapeutic approaches to combating bunyaviruses – a group of RNA viruses with high pandemic potential.
Fraunhofer WKI im Wissenschaftsschaufenster: Die bunte Welt der Pilze
Wie biomedizinische Translation eine bessere Versorgung von Menschen mit Seltenen Erkrankungen ermöglichen kann
Hauptsache, man tut es!
Zum Darmkrebsmonat März macht das Deutsche Krebsforschungszentrum (DKFZ) auf die Ergebnisse einer neuen Studie aufmerksam: Sowohl regelmäßige Stuhltests als auch Vorsorge-Darmspiegelungen können die Zahl der Darmkrebserkrankungen und Todesfälle deutlich senken – bei konsequenter Teilnahme sind beide Strategien ähnlich wirksam.
Tag der Seltenen Erkrankungen: Paragangliome im Kopf-Hals-Bereich – selten, gutartig, aber keineswegs harmlos
Haushalt als blinder Fleck der Lebensmittelsicherheit
Haushaltskühlschränke gelten als eine der wichtigsten Barrieren gegen lebensmittelbedingte Infektionen. Sie verlangsamen mikrobielles Wachstum, verlängern Haltbarkeiten und sind ein zentraler Bestandteil der Kühlkette. Eine neue Studie der Vetmeduni zeigt nun jedoch, dass Kühlschränke weit mehr sind als inerte Aufbewahrungsorte: Sie stellen komplexe, dynamische mikrobielle Lebensräume dar – mit direkter Relevanz für Lebensmittelsicherheit, Hygiene und Antibiotikaresistenz.
DDG warnt vor einer wachsenden digitalen Kluft in der Diabetesversorgung
Digitale Gesundheitsanwendungen (DiGA), kontinuierliche Glukosemessung (CGM) und algorithmengestützte Systeme (AID) verbessern die Diabetesprävention und -therapie erheblich. Doch nicht alle Menschen mit Diabetes profitieren gleichermaßen von diesen Fortschritten, kritisiert die Deutsche Diabetes Gesellschaft (DDG). Wer keinen Zugang zu Technik, ausreichende digitale Kompetenz hat, oder aber eine analoge Versorgung bevorzuge, drohe abgehängt zu werden. Die DDG stellte auf ihrer heutigen Jahrespressekonferenz in Berlin konkrete Forderungen für eine sozial gerechte Digitalisierung in der Diabetesversorgung vor.