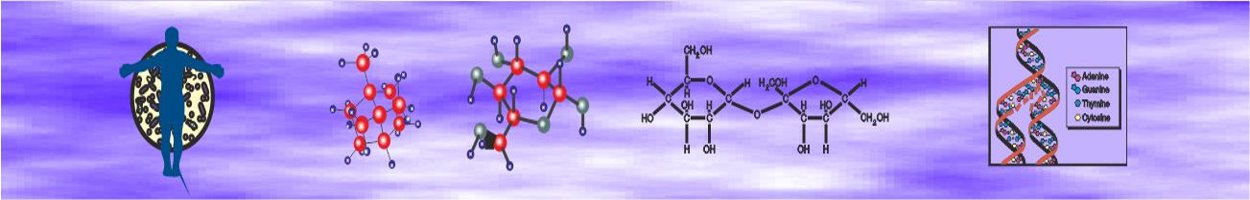Schlagwort: IDW
„Die DSG Stroke Unit Winter School hat sich mit ihrem interprofessionellen Charakter etabliert!“
Fire-footed rope squirrels identified as a natural reservoir for monkeypox virus
Feuerfußhörnchen als natürliches Reservoir für das Affenpockenvirus identifiziert
Neurologische Krankheiten haben die höchste Krankheitslast – auch in Deutschland
Der Verlust von Haustieren und das Tabu des Todes
Forscher:innen der Veterinärmedizinischen Universität Wien untersuchten ein oft übersehenes Thema, nämlich den Tod von Haustieren in der gegenwärtigen Gesellschaft. Präziser befasst sich eine aktuelle Studie unter der Leitung von Svenja Springer und Co-Autor Christian Dürnberger vom Messerli Forschungsinstitut mit den sozialen Dimensionen des Todes von Heimtieren, betrachtet durch die Linse der so genannten Thanatosoziologie.
Hülsenfrüchte stärken regionale Landwirtschaft und Ernährung – Potenziale in Brandenburg und Deutschland
New software detects hidden errors in complex tissue analyses
Neue Software erkennt versteckte Fehlerquellen in komplexen Gewebeanalysen
Handlungsfähig trotz Dauerkrisen: Resilienz entscheidend für Versorgung und Forschung – Opinion Leader Meeting der DGIM
Zusammenhang von Geburtsmonat und Essverhalten
DNAzymes for a pioneering cancer therapy
The Federal Ministry of Research, Technology and Space (Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt – BMFTR) is funding a promising new therapy approach to fighting cancer at Heinrich Heine University Düsseldorf (HHU). In the “DNAmazing” project, the team headed by Dr Manuel Etzkorn is collaborating with Professor Dr Philipp Lang from University Hospital Düsseldorf (UKD) to develop a highly selective therapeutic agent and found a new company to get it into clinical trials. The funding totals 3.2 million euros over a period of two and a half years.
Bluthochdruck im Fokus: EU-„Safe Hearts Plan“ und neue Aufklärungsmaterialien der Hochdruckliga
Wie verändern Weltraumflüge den Organismus? Bioinformatiker werten dafür Geninformationen aus
Woher kommt die Nahrung für Algen auf dem grönländischen Eis?
Effiziente „Horizonterweiterung“ für Chatbots: Sequenzmodelle profitieren von dosierter Nichtlinearität
– Für die Qualität der Anwendungen ist die Art des Modells entscheidend
– Forschende belegen: bei der Verarbeitung kontextbezogener Zusammenhänge übertrafen Modelle mit dosierter Nichtlinearität rein lineare und vollständig nichtlineare Modelle
– Die Integration dosierter Nichtlinearität wird als allgemein nützliches Designprinzip für daten-effiziente Sequenzmodelle angesehen
– Für die Analyse neuronaler Aufzeichnungen sind die Ergebnisse ebenfalls relevant: hier können kombinierte Modelle nicht nur Verhalten vorhersagen, sondern auch grundlegende Berechnungsprinzipien des Gehirns aufzeigen
Wie erforscht man eine Gottheit?
Mehr Teilhabe für Menschen mit Demenz durch Lokale Allianzen
City Life Makes for Less Picky Eaters
A new study published in the journal Urban Ecosystems has revealed that the common black garden ant (Lasius niger) behaves differently depending on whether it lives in a bustling city or the quiet countryside. The researchers, led by an international team from Ukraine, Germany, and Poland, found that urban ants are much more willing to accept low-concentration sugar solutions, which their rural counterparts typically reject. These findings suggest that the pressures of city living may be fundamentally altering their nutritional landscape.