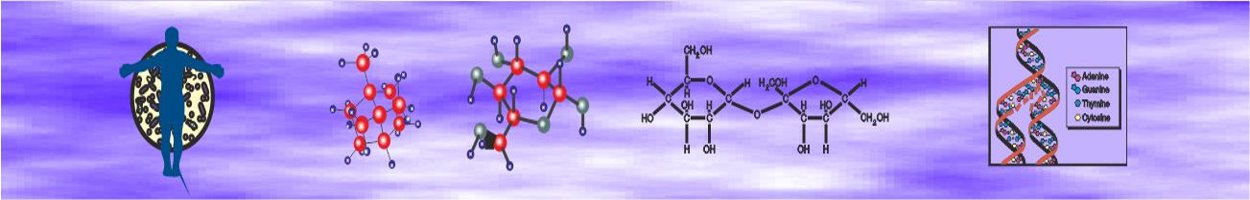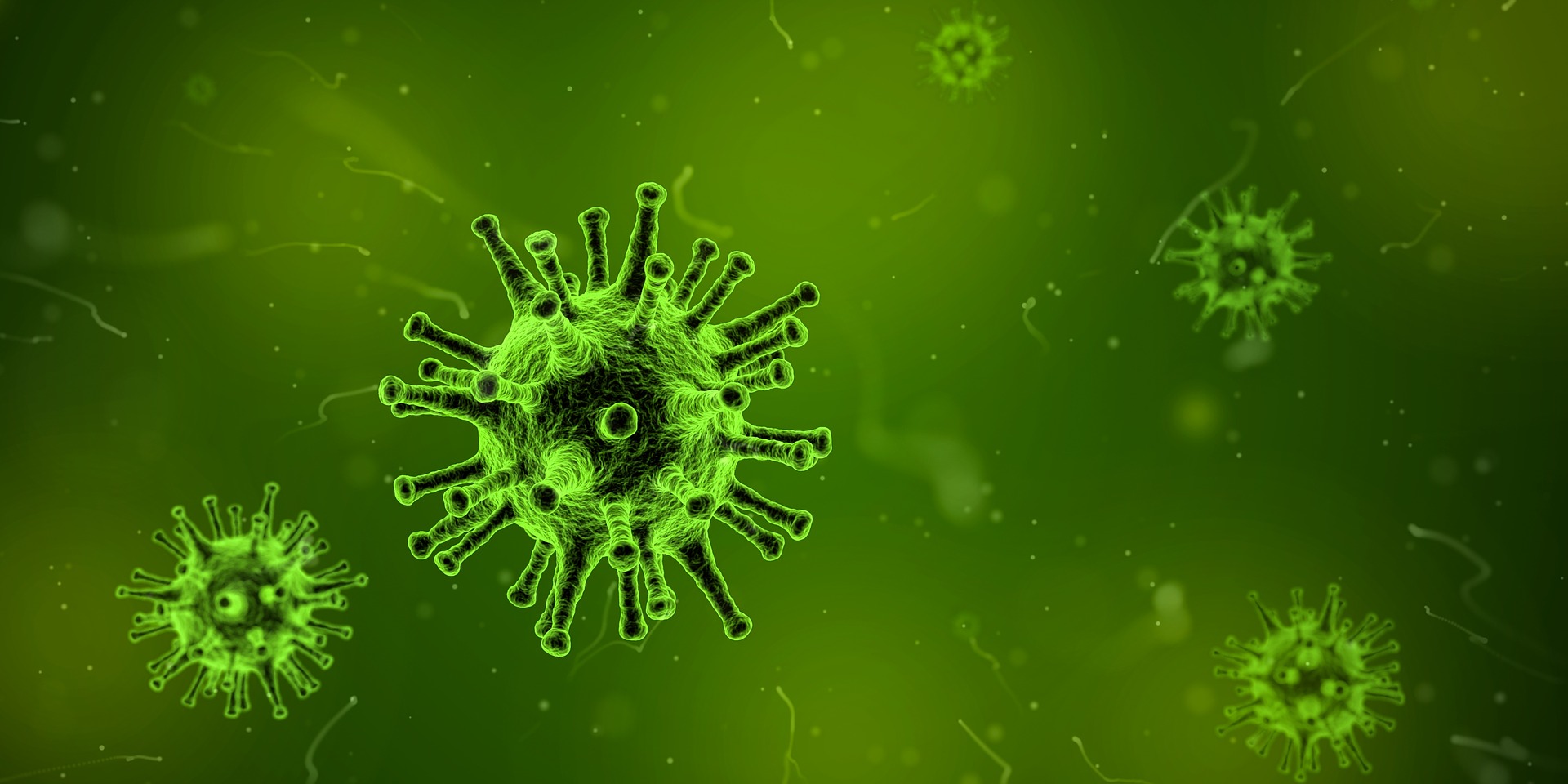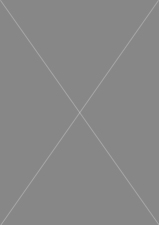Die letzten Meldungen
Europa erwärmt sich am schnellsten: Gesundheitsgefahr durch Hitze gehört längst zum Alltag – und braucht Strategien
24. April 2025
Sie kommt ohne Sirene, sie löst keinen Lockdown aus – und kostet
doch jedes Jahr Tausende von Menschenleben: Hitze ist längst zur unsichtbaren
Gesundheitskrise geworden. Allein im Sommer 2022 starben in Deutschland rund 9100
Menschen an den Folgen extremer Hitze (1) – deutlich mehr als durch Verkehrsunfälle und
Drogenkonsum zusammen. Dennoch fehlen vielerorts grundlegende Schutzmaßnahmen. Der
131. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Innere Medizin e. V. (DGIM) widmet sich im
Rahmen seines Schwerpunktthemas „Resilienz – sich und andere stärken“ der Frage, wie der
gesundheitliche Hitzeschutz systematisch gestärkt werden kann.
doch jedes Jahr Tausende von Menschenleben: Hitze ist längst zur unsichtbaren
Gesundheitskrise geworden. Allein im Sommer 2022 starben in Deutschland rund 9100
Menschen an den Folgen extremer Hitze (1) – deutlich mehr als durch Verkehrsunfälle und
Drogenkonsum zusammen. Dennoch fehlen vielerorts grundlegende Schutzmaßnahmen. Der
131. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Innere Medizin e. V. (DGIM) widmet sich im
Rahmen seines Schwerpunktthemas „Resilienz – sich und andere stärken“ der Frage, wie der
gesundheitliche Hitzeschutz systematisch gestärkt werden kann.
Untersuchung in der Kieler Bucht zeigt: Sedimentaufwirbelung durch Schleppnetzfang verringert CO2-Aufnahme deutlich
24. April 2025
24.04.2025/Kiel. Wenn Schleppnetze über den Meeresgrund gezogen werden, wirbeln sie Sediment auf. Dabei wird nicht nur organischer Kohlenstoff wieder freigesetzt, sondern auch die Oxidation von Pyrit verstärkt, was zu einer zusätzlichen Freisetzung von Kohlendioxid (CO2) führt. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie des GEOMAR, die anhand von Sedimentproben aus der Kieler Bucht die geochemischen Folgen untersucht hat. Ihr Fazit: Besonders Meeresbodenbereiche mit feinkörnigen Sedimenten, die für die CO2-Speicherung in der Ostsee entscheidend sind, sollten dringend unter Schutz gestellt werden. Die Studie ist in der Fachzeitschrift Communications Earth & Environment erschienen.
3D bioprinting: NMI, TU Darmstadt and Black Drop develop improved bioink
24. April 2025
3D bioprinting is a great hope in the field of regenerative medicine in order to produce miniaturized tissue and organ precursors with biological functionality. Today, however, scientists are still working on enabling nutrient transport in the 3D-printed tissue, for example. Researchers at the NMI in Reutlingen, the TU Darmstadt and Black Drop Biodrucker GmbH have now made important progress by incorporating electro-spun fibers into the bio-ink. This measurably improves nutrient transport.
Study investigates the impact of sediment resuspension induced by trawling and other natural processes in Kiel Bight
24. April 2025
24 April 2025/Kiel. When bottom trawls are dragged across the seafloor, they stir up sediments. This not only releases previously stored organic carbon, but also intensifies the oxidation of pyrite, a mineral present in marine sediments, leading to additional emissions of carbon dioxide (CO2). These are the findings of a study conducted by GEOMAR. Based on samples from Kiel Bight, the researchers investigated the geochemical consequences of sediment resuspension. Their conclusion: areas with fine-grained sediments, which play a crucial role in CO2 storage in the Baltic Sea, should urgently be placed under protection. The study has been published in Communications Earth & Environment.
3D-Biodruck: NMI, TU Darmstadt und Black Drop entwickeln verbesserte Biotinte
24. April 2025
Der 3D-Biodruck ist eine große Hoffnung im Bereich der regenerativen Medizin, um miniaturisierte Gewebe und Organvorläufer mit biologischer Funktionalität zu erzeugen. Heute arbeitet die Wissenschaft aber noch daran, etwa den Nährstofftransport in dem 3D-gedruckten Gewebe zu ermöglichen. Forschenden des NMI in Reutlingen und der TU Darmstadt ist nun ein wichtiger Fortschritt gelungen, indem sie elektro-gesponnene Fasern in die Biotinte eingebaut haben. Dadurch wird der Nährstofftransport messbar verbessert.
Phönizische Kultur verbreitete sich vor allem durch kulturellen Austausch
24. April 2025
Analysen alter DNA stellen unser bisheriges Verständnis der phönizisch-punischen Zivilisation in Frage. Ein internationales Forschungsteam hat Genomdaten von 210 Menschen aus der Antike analysiert und entdeckt, dass die phönizischen Städte in der Levante trotz enger kultureller, wirtschaftlicher und sprachlicher Verflechtungen nur wenig genetischen Einfluss auf die punische Bevölkerung im zentralen und westlichen Mittelmeerraum hatten.
How DNA Self-Organizes in the Early Embryo
24. April 2025
An international research team led by Helmholtz Munich has, for the first time, provided a detailed insight into how the spatial organization of genetic material is established in the cell nucleus of early embryos within the first hours after fertilization. Surprisingly, embryos demonstrate a high degree of flexibility in responding to disruptions in this process. The study, now published in Cell, reveals that no single master regulator controls this nuclear organization. Instead, multiple redundant mechanisms ensure a robust and adaptable nuclear architecture, allowing embryos to correct errors in the initial organization of their nucleus.
Wie sich die DNA im frühen Embryo selbst organisiert
24. April 2025
Ein internationales Forschungsteam unter der Leitung von Helmholtz Munich hat erstmals detailliert gezeigt, wie sich die räumliche Organisation des Erbguts im Zellkern früher Embryonen in den ersten Stunden nach der Befruchtung entwickelt. Überraschenderweise zeigen Embryonen eine hohe Flexibilität bei der Korrektur von Störungen in diesem Prozess. Die jetzt in Cell veröffentlichte Studie zeigt, dass nicht ein einzelner Hauptregulator diese Kernorganisation steuert. Stattdessen sorgen mehrere redundante Mechanismen für eine robuste und anpassungsfähige Kernarchitektur und ermöglichen es Embryonen, Fehler in der anfänglichen Organisation ihres Zellkerns zu korrigieren.
Unter Fluss – die Zellkultur der Zukunft
24. April 2025
Menschliche Zellen unter Fluss in einem handlichen System kultivieren – das ist mit einer Augsburger Erfindung bald möglich. Ein neues, am Lehrstuhl für Technische Biologie entwickeltes System ermöglicht diese sogenannte dynamische Kultivierung. Damit können körperähnliche Funktionen wie z.B. der Blutfluss erzeugt und aussagekräftigere Ergebnisse in der Medikamententestung erzielt werden. Das patentierte System ist handlich, mobil einsetzbar und mit gängiger Labortechnik kompatibel. Das Projekt „CELLenger“ wird für 1,5 Jahre mit 300.000 Euro durch das Bayerische Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie gefördert.
Weitere Notfallzulassungen gegen die Schilf-Glasflügelzikade
24. April 2025
Anwendung nun auch in Kartoffeln möglich, Wurzelgemüse soll folgen
Neurobiologie: Filme „spielen“ sich im Gehirn als oszillatorische Sinfonie ab
23. April 2025
LMU-Forschende haben gezeigt, dass das Gehirn natürliche visuelle Reize durch bestimmte oszillierenden Aktivitätsmuster im visuellen Neokortex verarbeitet.
Elephant Instead of Wild Boar? What Could Have Been in Europe
23. April 2025
Even under today’s climatic conditions, the long-extinct straight-tusked elephant could still live in Europe. This is the conclusion of a recent study. For this finding, the Sport Ecology research group at the University of Bayreuth combined fossil finds with reconstructions of past climates. The researchers present their findings in the journal Frontiers of Biogeography.
Waldelefant statt Wildschwein? Was in Europa hätte sein können
23. April 2025
Auch unter heutigen Klimabedingungen könnten in Europa die längst ausgerotteten europäischen Waldelefanten leben. Das ist das Ergebnis einer aktuellen Studie. Ein Forschungsteam des Lehrstuhls für Sportökologie an der Universität Bayreuth hat dazu Fossilfunde mit Rekonstruktionen des vergangenen Klimas kombiniert. Über ihre Ergebnisse berichten die Forschenden im Fachjournal Frontiers of Biogeography.
New regulatory protein of the neuronal cytoskeleton identified
23. April 2025
The growth and function of nerve cells is based on a lattice-like structure called membrane-associated periodic skeleton (MPS). However, how the organization of the MPS is controlled has not been elucidated until now. A team from the Max Planck Institutes for Medical Research and for Multidisciplinary Sciences has now discovered that it is regulated by the concentration of the protein paralemmin-1.
Neues regulierendes Protein des Zytoskeletts in Nervenzellen identifiziert
23. April 2025
Das Wachstum und die Funktionsweise von Nervenzellen stützen sich auf eine gitterartige Struktur, das membranassoziierte periodische Skelett, kurz MPS. Wie die Organisation des MPS gesteuert wird, war bisher nicht bekannt. Nun hat ein Team der Max-Planck-Institute für medizinische Forschung sowie für Multidisziplinäre Naturwissenschaften entdeckt, dass die Organisation von der Konzentration des Proteins Paralemmin-1 bestimmt wird.
Malfunctions in mitochondria influence skeletal ageing
23. April 2025
New mechanisms discovered that show how development-dependent disruptions in mitochondrial function lead to premature skeletal ageing / publication in ‘Science Advances’
Funktionsstörung von Mitochondrien beeinflusst die Skelettalterung
23. April 2025
Neue Mechanismen aufgedeckt, die zeigen, wie entwicklungsabhängige Störungen der Mitochondrienfunktion zur vorzeitigen Skelettalterung führen / Veröffentlichung in Science Advances
Was das Auge über die psychische Gesundheit verrät
22. April 2025
Eine neue Studie unter Leitung der Universität Zürich zeigt: Hinweise auf ein erhöhtes Schizophrenie-Risiko lassen sich bereits in der Netzhaut finden. Das könnte künftig zur besseren Früherkennung beitragen.
Retinal Clues to Mental Health
22. April 2025
A new study led by the University of Zurich has shown that evidence of genetic susceptibility to schizophrenia can be found in the retina. This finding could help improve the early detection of the disorder.
Kulturpflanzen: Genschalter macht Zuckerhirse salztolerant
22. April 2025
Sorghumhirse gilt als Kulturpflanze der Zukunft: Sie baut besonders viel Biomasse auf und gedeiht auch unter harschen Bedingungen. Bestimmte Sorten bilden auf salzigen Böden sogar mehr Zucker. Diese salzstress-bedingte Zuckeransammlung haben nun Forschende des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) in einem internationalen Team genauer untersucht und festgestellt, dass der Genschalter SWEET13 den Zucker in die Körner lenkt. Durch Züchtung lässt sich SWEET13 in verschiedene Sorten der Sorghumhirse einkreuzen, um zur Ernährungssicherheit beizutragen. Über ihre Ergebnisse berichten die Forschenden in der Fachzeitschrift Scientific Reports (DOI: 10.1038/s41598-025-90432-2).
Unkontrollierte Glutamatausschüttungen im Gehirn
22. April 2025
Unser Gehirn benötigt eine konstante Zufuhr von Energie. Störungen, zum Beispiel durch einen Schlaganfall, können schwerwiegende Komplikationen haben. Ein Forschungsteam vom Lehrstuhl Zelluläre Neurobiologie der Ruhr-Universität Bochum, an dem auch Forschende der Universitäten Düsseldorf und Twente beteiligt waren, hat untersucht, wie sich ein Energiemangel im Gehirn auf die Freisetzung des Neurotransmitters Glutamat auswirkt. Die Forschenden fanden heraus, dass unter Stress ungewöhnliche Glutmatfreisetzungen ablaufen, die sich selbst verstärken und so zur Schädigung von Nervenzellen beitragen dürften. Die Forschenden um Dr. Tim Ziebarth berichten im Journal iScience vom 18. April 2025.
Aktivität stabilisiert Gemische
22. April 2025
Asymmetrische Wechselwirkungen zwischen Molekülen können als stabilisierender Faktor für biologische Systeme dienen. Ein neues Modell der Abteilung Physik lebender Materie am Max-Planck-Institut für Dynamik und Selbstorganisation (MPI-DS) zeigt diese regulierende Rolle der Nicht-Reziprozität. Die Wissenschaftler*innen erforschen die physikalischen Prinzipien, auf deren Grundlage Teilchen und Moleküle Lebewesen und schließlich Organismen bilden können.
Die neuen Hebammen: Wissenschaft trifft Wunder
18. April 2025
Die Geburtshilfe verändert sich. Sie orientiert sich mehr an der Forschung. Sie wird akademisch – und dabei haben 24 junge Frauen jetzt Geschichte geschrieben: Sie sind die ersten Absolventinnen des Studiengangs Hebammenwissenschaft am Bamberger Standort der Hochschule Coburg. Ihr akademischer Abschluss wurde in einem feierlichen Festakt gewürdigt.
Neurodegenerative disease ALS: Cellular repair system could prevent protein aggregation
18. April 2025
Researchers at Goethe University, Johannes Gutenberg University Mainz and Kiel University discover possible method for preventing protein aggregates – Cluster4Future PROXIDRUGS research project
Nervenkrankheit ALS: Zellulärer Pannendienst könnte Proteinverklumpung vermeiden
18. April 2025
Forschende der Goethe-Universität, der Johannes Gutenberg-Universität Mainz und der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel entdecken möglichen Weg zur Vermeidung von Proteinaggregaten – Forschungsprojekt des Zukunftsclusters PROXIDRUGS