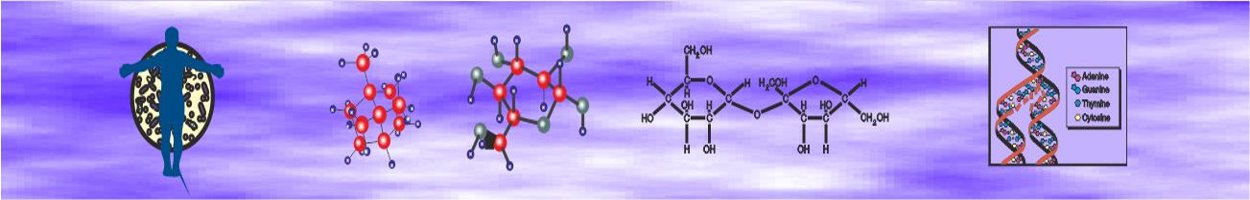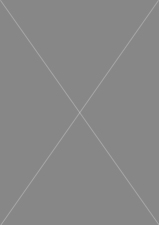Schlagwort: Pflanzen
Pflanzen können die Intensität von Salzstress messen
Just-in-time-Produktion: Wie Pflanzen intelligent Chlorophyll produzieren
In der Photosynthese wandeln Pflanzen mittels Chlorophyll die uneingeschränkt zur Verfügung stehende Sonnenenergie in biochemische Energie um, die sie für ihren Stoffwechsel nutzen. Wie stellen Pflanzen Chlorophyll allerdings her und wie schaffen sie es, immer ausreichende Mengen des grünen Pigments zur Verfügung zu haben?
Bestäubung durch Krebstiere
Bis vor Kurzem bestand die Annahme, dass eine Bestäubung durch Tiere ausschließlich Pflanzen an Land vorbehalten ist. Ein internationales Forscherteam hat nun herausgefunden, dass kleine Meereskrustentiere die Vermehrung von Rotalgen fördern, indem sie das Sperma von den männlichen zu den weiblichen Organismen weitertragen. Ihre Ergebnisse deuten darauf hin, dass Meerestiere schon viel länger als Arten an Land eine Rolle bei der Befruchtung spielen.
Geschichte des Roggens: Wie frühe Landwirte die Pflanzen genetisch unflexibler machten
Resistenz gegen Mosaikkrankheit aufgeklärt
Foto-Challenge: Wer fotografiert die meisten Hummeln?
Wie sich Wasserflöhe gegen fleischfressende Pflanzen verteidigen
Proteinfaltung in Zeiten von Sauerstoffmangel
Kleine Moleküle mit großer Wirkung für die Immunabwehr von Pflanzen
Materialien auf Pilzbasis vielversprechend für die Praxis
Wie können sich Pflanzen an den Klimawandel anpassen?
• Erforschung der damaligen molekularen und morphologischen Prozesse soll helfen, heutige Pflanzen besser an den Klimawandel anzupassen
• Prof. Dr. Stefan Rensing gibt Überblick zum Forschungsstand und steht für Interviews bereit
Vortrag: Pflanzen und Klimawandel
Was ein Teebeutel über das Insektensterben erzählen kann
Baustein für ein längeres Leben
Kranke Pflanzen und falsches Parfüm lassen sich schnell, zuverlässig und in Echtzeit identifizieren
Gemeinsame Pressemitteilung des Max-Planck-Instituts für Chemie und der Johannes Gutenberg-Universität Mainz
Die Funktion folgt der Form in der Pflanzenimmunität
Überwachung der Artenvielfalt per Satellit rückt in Reichweite
Artenschutz für Pilze
Vegetarische Alternativen: Die andere Art von Fleisch

Würste, Salami und Hack aus Pflanzen werden immer beliebter. Doch was steckt drin im vegetarischen Fleischersatz? Und sind die Alternativen zum Tier gesund?
Vegetarische Alternativen: Die andere Art von Fleisch

Würste, Salami und Hack aus Pflanzen werden immer beliebter. Doch was steckt drin im vegetarischen Fleischersatz? Und sind die Alternativen zum Tier gesund?