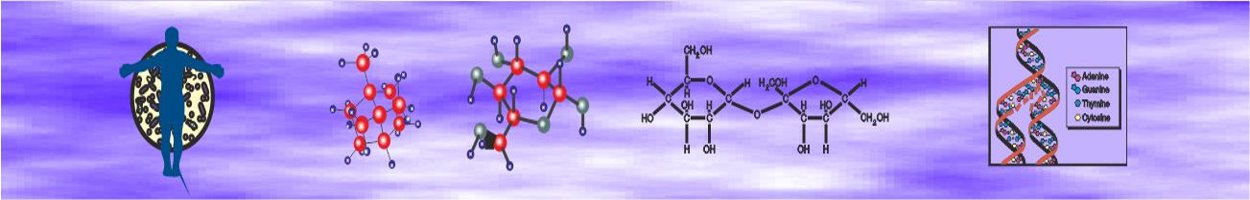Schlagwort: Pflanzen
Wegweiser durchs Genom
ZALF-Studie: Silizium-Düngung steigert Weizenerträge und Wasserverfügbarkeit
Umweltwissenschaftliche Vortragsreihe: Nachhaltiger Pflanzenanbau im Zeichen des Klimawandels
Artenvielfalt in der Hauptstadt: Botanischer Garten Berlin ruft zur Beteiligung an iNaturalist City Nature Challenge auf
Botanischer Garten der HHU im Frühling: Blühende Bäume, beeindruckende Blumen
Konkurrenz unter Bakterien sorgt für Wohlergehen von Pflanzen
An der „Auferstehung“ sind viele Gene beteiligt
Forscherteam entdeckt in Arabidopsis thaliana neuen Signalweg bei niedrigem Sauerstoffgehalt
IPK-Forscher geben Einblick in den Mechanismus der Ertragsbildung bei Gerste
Samenkeimung: Die Doppelrolle der Lichtrezeptoren
Zelluläre Müllabfuhr: Wie der “Selbstverzehr” molekular reguliert wird
Zikaden beim Saugen zuschauen, um Pflanzen zu schützen
Neuer Wirkstoff aus Bakterien könnte Pflanzen schützen
Fleischfressende Pflanzen stellen ihre Ernährung um – Fangfallen als Toilettenschüsseln
Moose verzweigen sich anders… auch auf molekularer Ebene
Weniger Nachtfalter, mehr Fliegen
Mit einer Kombination aus alter Methode und moderner Technologie zu neuen Pflanzensorten
1.000 Pflanzen sequenziert – Protein reguliert Crossoverprozesse in Pflanzen
Ein Zellkompass für effizientes «Atmen» von Gräsern
Rostocker Team entschlüsselt Mechanismus zum Lichtschutz von Pflanzen
Wie Pflanzen sich bei Eisenaufnahme vor oxidativem Stress schützen – und warum dies auch für den Menschen wichtig ist
Eisen ist ein für das Überleben von Pflanzen wie Menschen entscheidender Mikronährstoff, doch zu viel Eisen kann auch toxisch sein. Ein interdisziplinäres Forschungsteam der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf (HHU) hat festgestellt, dass das Protein PATELLIN2 nicht nur den Eisenhaushalt in Pflanzen mitreguliert. PATELLIN2 gehört zu einer Gruppe von Proteinen, die auch am Vitamin-E-Transport im Menschen beteiligt sind. Die Ergebnisse, die ebenfalls für die Eisenversorgung des Menschen über pflanzliche Nahrung wichtig sind, stellen die Forschenden in der Fachzeitschrift Plant Physiology vor.
Vanille und Pfeffer made in Osnabrück: Forschungszentrum „Agrarsysteme der Zukunft“ der Hochschule Osnabrück eröffnet
Vegetarische Alternativen: Die andere Art von Fleisch

Würste, Salami und Hack aus Pflanzen werden immer beliebter. Doch was steckt drin im vegetarischen Fleischersatz? Und sind die Alternativen zum Tier gesund?
Vegetarische Alternativen: Die andere Art von Fleisch

Würste, Salami und Hack aus Pflanzen werden immer beliebter. Doch was steckt drin im vegetarischen Fleischersatz? Und sind die Alternativen zum Tier gesund?